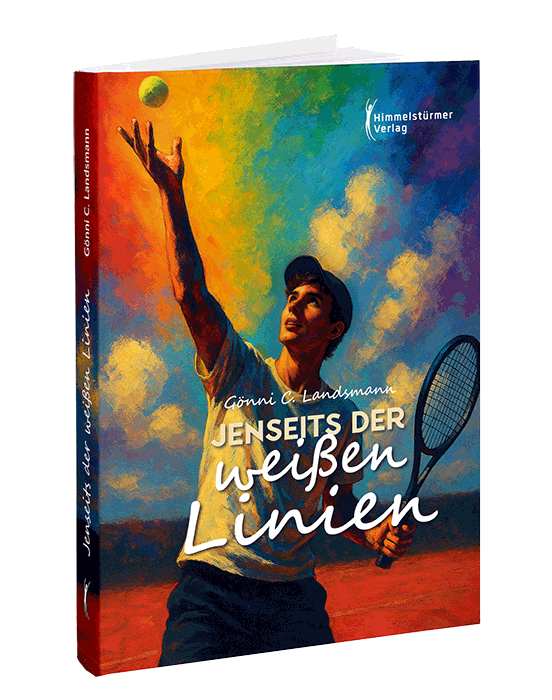ÜBER GÖNNI
Hallo! Mein Name ist Gönni C. Landsmann, ich bin nicht-binär und benutze keine Pronomen. Ich stamme aus dem idyllischen Schwarzwald und lebe seit vielen Jahren in Frankfurt am Main – einer Stadt, die mich geprägt hat und in der ich mich zwischen U-Bahn-Gewusel, queerer Wahlfamilie und Buchhandlungen zuhause fühle. Studiert habe ich Soziologie, Kulturanthropologie sowie Kinder- und Jugendliteratur – eine Kombination, die meine Sicht auf Menschen, Sprache und Geschichten stark beeinflusst hat.
Ich schreibe, weil ich neugierig bin. Nicht nur auf Geschichten, sondern auf das, was sich zwischen ihnen abspielt. Mich interessieren Zwischenräume – jene unscharfen, oft übersehenen Orte zwischen klaren Kategorien, zwischen Innen und Außen, zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was darunter liegt. Schreiben ist für mich eine Möglichkeit, genau dorthin zu schauen. Auf Figuren, die nicht glatt sind, nicht eindeutig, nicht immer laut – und gerade deshalb so menschlich. Ich glaube an Texte, in denen Unsicherheiten Platz haben dürfen. In denen Figuren nicht funktionieren müssen, sondern einfach existieren können – mit all ihren Brüchen, Widersprüchen und ihrer ganz eigenen Sprache.
Ich schreibe keine Geschichten, um etwas zu erklären. Ich schreibe, um etwas fühlbar zu machen. Um Räume zu öffnen – für Zweifel, für Zwischentöne, für das Ungeklärte. Meine Figuren stehen häufig an den Rändern, aber nicht, weil ich sie dort „abbilden“ möchte, sondern weil sie sich dort bewegen, ungehört, ungeordnet, unbemerkt. Ich will ihnen Raum geben – nicht als Lehrstücke, nicht als „Repräsentation“, sondern als selbstverständliche, vielschichtige Figuren. Ich bin überzeugt davon, dass Literatur nicht sichtbar machen muss, um politisch zu sein. Manchmal reicht ein Gedanke. Ein Blick. Eine Berührung. Manchmal ist ein stiller Satz subversiver als jede Schlagzeile.
Besonders interessieren mich Spannungsfelder. Ich schreibe dort, wo sich zwei Pole gegenüberstehen – oder überlagern: zwischen Sichtbarkeit und Rückzug, zwischen Nähe und Distanz, zwischen der Sehnsucht, verstanden zu werden, und dem Bedürfnis, sich zu schützen. Meine Figuren sind keine klassischen Held*innen. Sie scheitern, schweigen, verdrängen, versuchen es erneut. Sie streiten, ziehen sich zurück, lieben still, kämpfen mit sich. Sie dürfen existieren, ohne sich ständig erklären oder rechtfertigen zu müssen. Ich nehme sie ernst – und lerne beim Schreiben immer wieder selbst von ihnen.
Was das Handwerkliche betrifft, schreibe ich in Etappen mit Pausen, die ich oft für notwendig halte, obwohl sie manchmal wie Aufschub wirken. Ich bin keine disziplinierte Vielschreiber*in, sondern jemand, der sich durch Sätze tastet. Ich ringe mit Worten, feile an Formulierungen, streiche und ergänze, bin oft streng mit mir – und zuweilen auch selbstironisch. Oscar Wilde hat einmal gesagt: „Ich habe den ganzen Vormittag damit verbracht, ein Komma zu entfernen – und den Nachmittag damit, es wieder einzufügen.“ Ich fühle mich diesem Satz sehr verbunden.
Ich schreibe mit mehr Kaffee als gesund für mich ist, mit zu vielen geöffneten Tabs, mit Musik im Hintergrund, die ich irgendwann nicht mehr höre. Ich schreibe mit Ablenkungen – aber auch mit großer Hingabe, wenn mich ein Gedanke trifft. Manchmal dauert es lange, bis ich beginne. Aber wenn ich erst einmal in eine andere Welt eingetaucht bin, verlieren Zeit und Struktur ihre Bedeutung. Dann folgt das Schreiben einem eigenen Rhythmus, einer eigenen Logik, einer eigenen Form von Aufmerksamkeit.
Für mich ist das Schreiben kein disziplinierter Akt, sondern ein Zustand. Eine Möglichkeit, das Unsagbare wenigstens anzudeuten. Etwas zu berühren, das zwischen den Zeilen liegt. Ich wünsche mir, dass meine Texte etwas in Bewegung setzen – nicht unbedingt groß, aber spürbar. Vielleicht nur für einen Moment. Vielleicht für einen Satz. Wenn jemand innehält, weil eine Figur etwas denkt, das sie selbst nie aussprechen konnte, dann hat sich der ganze Prozess gelohnt.
Ich schreibe, weil ich glaube, dass Geschichten keine Antworten geben müssen. Es reicht, wenn sie Fragen stellen, die man anderswo nicht stellen darf. Und manchmal reicht es auch einfach, dass sie da sind – als Möglichkeit, als Einladung, als leiser Widerstand gegen das Vergessenwerden.
Wer mehr über meine Geschichten oder mich erfahren möchte, kann gerne auch auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen.